Schottische Elfen
Die schottischen Elfen heißen Doane Shi. Sie sind vom Wesen her ein gutes Völkchen, das von den Engeln abstammen soll. Sie wurden jedoch verstoßen, weil sie sich vom Teufel verführen ließen. [1] Die Elfen Schottlands werden als sehr schön und klein beschrieben. Sie haben eine zierliche Gestalt, glänzende Augen, die Zähne und die Körperfarbe ist elfenbeinartig. Und sie tragen dunkelbraune, lockige Haare. Ihre Kleidung ist grün, manchmal auch braun.
| Sie leben in Höhlen oder in Schluchten. Ihre Wohnungen ähneln Steinhaufen oder Erdhügeln, da sie sehr unregelmäßig sind. Auch sind Türen, Fenster und Rauchfänge vor dem menschlichen Auge gut versteckt. Nur in der Nacht weist ein glänzendes Licht darauf hin, dass sie bewohnt sind. In der schottischen Grafschaft Pertshire leben sie auch in runden Grashügeln. Bei Mondlicht kann man die Elfen tanzen sehen. Meistens sieht der Mensch aber nur ihre Spuren. Diese sind gelb und ab und zu eingetreten, manchmal auch dunkelgrün. Die Elfen tanzen und spielen dazu eine wunderschöne Musik. Trotzdem sollen sie neidisch auf das Glück der Menschen sein. So sind sie zwar vom Wesen her gut, aber ab und zu doch etwas neidisch und griesgrämig. |  |
Menschen können ab und zu in die Wohnungen der Elfen gelangen. So gibt es aus Pertshire die Überlieferung, dass jemand, der am Heiligen Abend neun Mal um einen Elfenhügel geht, eine Türe finden wird, durch die er hinein kommen kann.
Es gibt Sagen über Menschen, die von den Elfen durch Tanz und Musik angelockt werden und dann freiwillig bei ihnen bleiben. Außerhalb des Elfenbereichs vergeht die Zeit schneller, während es den Menschen, die sich in der Gewalt der Elfen befinden, erscheint, als würden erst einige Stunden vergangen sein. Will man jemand aus der Gewalt der Elfen befreien, so muss dies laut den Überlieferungen nach einem Jahr und einem Tag geschehen oder kann nur am Heiligen Abend passieren, wenn die Elfen ihren Zug abhalten. Isst der Mensch jedoch nur ein bisschen von den Speisen, die ihm die Elfen geben, so muss er auf ewig bei ihnen bleiben.
Andere Überlieferungen berichten, dass jemand, der von den Elfen gefangen gehalten wird, nach sieben Jahren zu den Menschen zurückkehren darf. Allerdings verschwindet er nach sieben Jahren wieder und wird dann nicht mehr gesehen. Andere Legenden besagen, dass die Elfen einen Menschen nach sieben Jahren dem Teufel opfern.
Die Legende von der Frau eines Pächters
Die Frau eines Pächters in der Stadt Lothian wurde
von den Elfen gefangen gehalten, durfte aber jeden Sonntag für ein paar
Stunden nach Hause. Sie kämmte ihren Kindern die Haare und erzählte dabei
ihren Mann, wie er sie wieder bekommen könnte, sagte ihm aber, er müsse
sehr mutig sein. Der Mann wartete am Heiligen Abend auf den Zug der Elfen.
Als dieser jedoch auftauchte und fürchterliche, geisterhafte Laute zu ihm
herüber drangen, verließ den Mann der Mut. Als der letzte Reiter des
gespenstischen Zuges vorbei geritten war, brach der gesamte Zug in Lachen
und Jubel aus. Inmitten dieser Stimmen erkannte der Pächter jedoch die
seiner Frau, die weinte, da sie nun nie mehr zurückkehren durfte.
Geschickte Elfen
Elfen sind handwerklich sehr begabt – sie können
schneidern, weben und Schuhe machen. Auch darüber gibt es verschiedene
Sagen. Eine handelt von einem Weber, der in der Nacht von einem Geräusch
geweckt wurde. Er schaute nach und sah einige Elfen, die sich seiner Geräte
bedienten. Sie machten aus Wolle ein feines Tuch. Als es Morgen wurde, zogen
die Elfen wieder ab. Beim Weber bedankten sie sich nicht für die
unfreiwillige Gastfreundschaft.
Einige Überlieferungen berichten von den
wundersamen Bauwerken des Michael Scott (Baumeister um 1290), die er mit der
Hilfe von Feen gebaut haben soll.

Nachbarschaft mit den Elfen
Da die Elfen ihre Wohnungen auch ab und zu in der Nähe
der Menschen haben, sind die Menschen natürlich daran interessiert, mit
ihnen gut auszukommen. So kommt alles Flüssige, das die Menschen auf den
Boden schütten, den Elfen zu Gute. Sie kommen auch öfter und borgen von
den Menschen bestimmte Dinge. Die Menschen nennen sie dann gute Nachbarn,
die dafür sorgen, dass es der Familie gut geht und helfen ihnen.
So gibt es die Legende von einem Pächter in
Strathsprey, der von einer Elfe als Geschenk erhielt, dass er immer genug
Kornsamen haben werde, um seine Äcker zu bepflanzen. Als der das jedoch
seiner Frau erzählte, konnte diese ihren Mund nicht halten und erzählte
diese wundersame Begebenheit herum. Deshalb wurde dieser Zauber gebrochen.
Boshaftigkeit der Elfen
Die Elfen stehlen den Menschen gerne Dinge –
dabei verwenden sie allerlei Tricks, verwandeln sich beispielsweise einen
Wirbelwind oder sie lassen etwas in Flammen aufgehen.
So erzählt eine Legende von einer Elfenfrau, die
im schottischen Craig-ail-naic wohnte. Diese kam zu einer Pächtersfrau und
bat sie um Mehl, das sie ihr bald zurückgeben werde. Die Pächtersfrau
hatte Angst und gab ihr das Gewünschte. Dann forderte sie die Elfenfrau
auf, ihr zu folgen. Als sie nun vor den Toren der Stadt auf einem Hügel
waren, gab die Elfin der Frau das Mehl zurück und erklärte, sie habe nun
das, auf was die gewartet habe. Die Pächtersfrau nimmt ihr Mehl und geht
zurück. Wenige Minuten später sieht sie, wie der Kornboden eines
benachbarten Gutes in Flammen aufgeht.
Vielen Legenden nach sollen die Elfen auch Kinder
stehlen und ihre eigenen dafür in die Wiege legen. Will eine Mutter ihr
Kind vor den Elfen schützen, so soll sie den Kopf des Kindes herunter hängen
lassen, wenn sie es am Morgen ankleidet. Bindet man dem Kind einen roten
Faden oder ein Kreuz um den Hals so schützt auch das. Wurde das Kind
hingegen schon ausgetauscht, kann man es wieder erhalten, wenn man den
Wechselbalg an die Stelle legt, wo drei Länder oder drei Flüsse zusammen
kommen – und zwar noch vor Einbruch der Dunkelheit. In der Nacht bringen
die Elfen dann das echte Kind wieder und nehmen den Wechselbalg mit.
An der Ostküste von Schottland gibt es auch einen
Brauch gegen Wechselbälger: Man schneidet bei zunehmenden Mond im März
Eichen- und Efeuzweige ab und flechtet daraus Kränze, die bis zum nächsten
Herbst aufbewahrt werden. Wenn das Kind abmagert oder zusammen bricht, lässt
man es drei Mal durch diesen Kranz gehen.
Genau so wie den Wassermännern wird auch den Elfen
nachgesagt, dass sie Frauen stehlen sollen, die kurz vor der Geburt stehen.
Elfen töten Tiere und Menschen
Mit einem Elfenkeil oder auch Elfbolt genannt, töten
die Elfen Menschen und Tiere. Dies ist ein Zauberpfeil, dessen Keil häufig
die Form eines Herzens besitzt. Die Keile sind gelblich und hart und von
unterschiedlicher Größe. Wen die Elfen mit dieser Waffe berühren, der
muss sterben. Und die Elfen treffen fast immer. Der Mensch oder das Tier fällt
augenblicklich tot zu Boden. Ein anderer Mensch kann den Keil in dem Körper
nicht entdecken, wenn er nicht die Fähigkeit besitzt. Findet man ihn, dann
muss man ihn ganz vorsichtig entfernen und aufbewahren – denn wer den Keil
besitzt, dem können die Elfengeschosse nichts anhaben.
Auch die rohen Streit-Äxte aus Metall wurden von
Elfen gemacht. Hört man genau hin, kann man die Elfen damit in den Felsen hämmern
hören. Oft lassen sich in Flussbetten auch abgerundete Steine finden –
diese dienen den Elfen als Becher und als Schüsseln.
Das Elfstier und elfische Tiere
Werden an Herbsttagen die Tiere von der Weide
gebracht, so passiert es oft, dass diese wie verrückt herumlaufen und brüllen,
obwohl es keinen Grund dafür gibt. Wenn jedoch der Mensch durch ein
Elfastloch sieht oder durch die Wunde, die ein Elfenkeil durch die Haut
eines getöteten Tieres gemacht hat, so kann er das Elfstier sehen, das sich
mit dem Leitbullen streitet. Das Elfstier soll klein sein, mausgrau, hat
gestutzte Ohren, korkartige Hörner und kurze Beine. Es ist an Flussufern zu
finden und frisst in der Nacht grünes Korn. Wer das Elfstier einmal gesehen
hat, wird auf dem Auge, mit dem er es gesehen hat, erblinden.
Aus Schottland gibt es eine Sage aus dem 13.
Jahrhundert: Hier schlich sich eine Kuh von der Herde weg und trieb es mit
einem Elfstier, von dem sie dann auch ein Junges bekam. Die Kuh selbst
stirbt bei der Geburt, weil das Kalb so groß ist. Eine alte blinde Frau,
die in ihrer Jugend hellsichtig war, warnt die Leute, als sie das Kalb brüllen
hört. Sie sagt, man solle das Kalb gleich töten, weil es ein Elfstier ist.
Die Menschen schlagen die Warnungen auf Grund der Schönheit des Tieres natürlich
in den Wind. Das Kalb wird rasch größer und tötet im vierten Jahr mit
seinen Hörnen den Bauern.
Von den Färöer-Inseln und Island stammt die Überlieferung,
dass die großen und fetten Kühe und Schafe der Elfen unsichtbar in der
Viehherde weiden. In Deutschland kennt man eine blaue Kuh, die die Menschen
vor Feinden warnte und ihnen Verstecke zeigte.
In Schweden wiederum lässt die Meerfrau ihre
schneeweißen Kühe zum Weiden an den Strand.
Die Brownies
Der Brownie scheint auch zur Gattung der Elfen zu
gehören. Von der Gestalt her wird er als mager und zottig, aber auch als
schlank beschrieben. Der Name stammt von seiner Farbe ab. Er ist der Diener
seines Herrn, arbeitet Tag und Nacht und hilft ihm – und das alles für
ein altes Kleidungsstück und ein wenig Nahrung. Bei jeder anderen Art von
Entgelt soll der Brownie auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Er bleibt bei
der Familie, so lange noch einer der Familienmitglieder am Leben ist. In der
Nacht schläft er am Feuer.
Eine Legende erzählt, dass ein Brownie einer vor
der Geburt stehenden Frau das Leben rettete. Die Familie benötigte dringend
die Hebamme, doch der Knecht, der sie holen sollte, ließ sich Zeit. So warf
sich der Brownie das Gewand des Knechts über und ritt wie der Teufel, um
die alte Frau zu holen. Dem Knecht jedoch, der zu der Zeit, als der Brownie
mit der Hebamme wieder zurück gekehrt war, gerade dabei war, sich seine
Stiefel anzuziehen, versetzte er ein paar Schläge mit dessen eigener
Peitsche. Aus Dankbarkeit ließ ihm der Hausherr ein grünes, neues Kleid nähen.
Der Brownie nahm das Geschenk und verschwand.
Irische Elfen
Von
den weiblichen Elfen berichten schottische, irische, dänische und
schwedische Legenden, dass sie sehr reizvoll und verführerisch aussehen,
vergleichbar mit der Schönheit eines Menschen. Sagen aus Schottland oder
Wales beschreiben die Elfe als schönes, nicht sehr altes Kind. Vom Aussehen
her ist es sehr zart und besitzt feine Glieder. Die Elfen besitzen laut den
schottischen und walisischen Legenden alle lange Haare.
In
den Noten zur „Lady of the Lake“ schreibt der schottische Schriftsteller
Sir Walter Scott (15. August 1771 in Edinburgh, gest. 21. September 1832 in
Abbotsford) von einem Zwerg mit roten Haaren. Auch wird die schwedische
Waldfrau als klein mit blonden, lockigen Haaren beschrieben. Selbst die
Elfen der deutschen Sagen tragen blonde Locken.
|
Der
"Cluricaun" (1862) aus T.C.
Croker |
Das
Kämmen der Haare kommt in verschiedenen Überlieferungen vor,
beispielsweise bei beim Huldevolk – das sind die Elfen auf den Faröer-Inseln
oder bei den Huldrer, wie die norwegischen Elfen genannt werden. Und wie
schon in vorangegangenen Berichten über die Elementarwesen erwähnt, ist
das Kämmen der Haare auch eine Eigenheit der Wasserfrauen. Während
die himmlischen Elfen als schönes Völkchen beschrieben werden, gibt es darüber
hinaus auch noch die Dunkel- und Schwarzelfen, die hässlich aussehen
sollen. So gibt es zum Beispiel den Cluricaun aus der irischen Mythologie, ein enger Verwandter des Leprechaun, der ein Troll oder auch Kobold ist. Der irische Schriftsteller Thomas Crofton Croker behauptete in seinen 1825 erschienen „Fairy Tales and Traditions of the South of Ireland“, dass der Cluricaun in Wirklichkeit von „Luacharma'n“ abgeleitet ist, was wiederum Zwerg bedeutet. „Cluricaun“ heißen heute viele irische Pubs.
|
Verschiedenheit der Elfen
Wie
schon im ersten Teil der Sylphen erwähnt, tauchen die ersten Elfen in der
Edda auf, die für die Elfen Gegensätze von hell und dunkel nennt. Während
die dunklen Elfen von der Edda mit dem Namen „alfr“ mit den Zwergen
gleich gesetzt werden, sind die Lichtelfen wunderschön und fast
durchsichtig.
Auch
in vielen deutschen Legenden finden sich die Elfen als wunderschöne
Jungfrauen wieder, die sich nur so lange im Tageslicht zeigen dürfen, so
lange die Sonne am Himmel steht. Die Erdelfen haben eine dunkle Hautfarbe
und sind auch nur in der Nacht zu sehen. Wenn sie in die Sonne kommen,
werden sie von dieser zu Stein verwandelt.
Eine Mischung aus
beiden ist der Elberich, der im Nibelungenlied mit norwegischem Namen „wildez
getwerc“ heißt. Er lebt in Berghöhlen, ist aber körperlich und auch
geistig den Menschen überlegen. Wenn er aber eine Beziehung zu den Menschen
aufbaut, werden auch seine Bedürfnisse menschlicher. Vom Charakter her ist
der Elberich einerseits hilfsbedürftig, andererseits schimmert immer wieder
seine Überlegenheit durch.
Selbst im Wasser
sind die Elfen laut vieler Legenden zu finden – was auf eine Vermischung
mit den Nixen hindeutet. So können die Nixen manchmal auch über dem Wasser
schweben – eine Eigenschaft, die wiederum den Elfen zugesprochen wird.
In vielen
schottischen und dänischen Überlieferungen werden die Elfen als Weggefährten
des Teufels beschrieben. Dennoch gibt es auch viele Zwerge, die christlichen
Glauben angenommen haben, sogar helfen, Heiden zu taufen. So schreibt der
Historiker und Archivar Franz Josef Mone (geb. 12. Mai 1796 in Mingolfsheim,
gest. 12. März 1871 in Karlsruhe) seinem Otnit (der nichts anderes als der
Elberich ist) christliche Eigenschaften zu. Auch in deutschen Sagen finden
sich zuweilen diese christlichen Zwerge.

Elfen und deren
Beziehung zu den Menschen
Wie
auch die Nixen und Wassermänner lieben es die Elfen, die Menschen ab und zu
zu ärgern. Im Großen und Ganzen sind die Elfen jedoch hilfsbereit den
Menschen gegenüber. Das ist die Überlieferung der meisten irischen Sagen.
Trotzdem
gibt es noch eine andere Sichtweise: So glaubte man in Wales, dass alleine
der Anblick der Elfen einen Menschen töten könne oder zumindest gefährlich
sei. Thomas Bourke erwähnt in seinen „The confessions of Tom Bourke“
(erschienen Ende des 19. Jahrhunderts), dass ein Mensch vom Anblick einer
Elfe hohes Fieber bekommen oder sogar wahnsinnig werden könne. Walter Scott
(1771 bis 1832) schreibt in seiner „Lady of the Lake“, dass ein Junge,
der einen Zwerg gesehen hatte, krank wurde und noch innerhalb eines Jahres
starb. Auch der Zug der Elfen soll gefährlich sein: Von diesem soll sich
der Mensch fern halten und nicht hinsehen. Sieht man einen Elfen durch ein
Astloch, erblindet man auf diesem Auge.
Bei
dem schon erwähnten Elfenpfeil reicht die bloße Berührung und der Mensch
stirbt. Es gibt eine Sage von der Insel Man, nach der sich ein junger Mann
dem Kuss einer Elfe entzogen hat. Sie berührte ihn darauf hin mit ihrem
Pfeil. Der junge Mann empfand plötzlich große Angst und starb innerhalb
von sieben Tagen.
Selbst
der Atem der Elfen ist gefährlich, soll doch ein Mensch nach irischen und
schottischen Sagen, Beulen und Krankheiten bekommen, wenn ihn eine Elfe
anhaucht. In Norwegen wird ein Mensch vom so genannten Elfenfeuer, auch
Alv-Gust oder Alvild befallen, wenn er an einen Ort kommt, wo eine Elfe
uriniert oder auch gekotzt hat. In
den Sagen haucht der preußische Elf das Auge eines Menschen an, der
schottische Elf speit in das Auge. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Das Auge
erblindet. Der dänische Elf reißt das Auge sogar heraus.
Wenn
ein Mensch von den Elfen Essen und Getränke annimmt oder auch nur berührt,
kann er nach den schottischen Überlieferungen nicht mehr in sein Leben zurück.
Wer für die Elfen gearbeitet hat und von dem Geld, das sie ihm hinwerfen,
mehr nimmt als ihm zusteht, muss bei ihnen bleiben oder ist seines Lebens
nicht mehr sicher. Gelingt es einem Menschen nach einem Aufenthalt bei den
Elfen zu fliehen oder wenn sie ihn gehen lassen, heißt es in den
norwegischen Überlieferungen, dass dieser Mensch auf immer wahnsinnig oder
geistesgestört (elbisch) sein wird. Daher dachten die Menschen früher
auch, dass schwachsinnige Leute mit Elfen oder anderen unsichtbaren Wesen
reden könnten.
Elfen
mögen kleine Kinder, Jungen oder schöne Frauen. Diese bringen sie dann mit
Gewalt in ihre Gefangenschaft. So nehmen unsichtbare Hände der Mutter ihr
Kind weg oder die Nixen rauben die Kinder, indem sie sie ins Wasser ziehen.
Die Elfen wenden aber auch List an: Sie versprechen den Menschen Geschenke
oder locken sie durch Musik oder Tanz. Aus Wales gibt es den Aberglauben,
dass die Elfen ihren Opfern das Leben aussaugen, um dadurch wieder selber
jung zu werden. Natürlich gibt es auch in den irischen Sagen den Glauben,
dass die Elfen ihr eigenes Kind gegen ein Fremdes eintauschen, also die
Wechselbalg-Geschichte.
Menschen sollen
nach ihrem Tod den Elfen gehören. Daher feiern diese den Tod eines Menschen
mit einem rauschenden Fest. Nach den irischen Überlieferungen soll man auch
Elfen auf dem Wasser tanzen sehen, bevor ein Kind ertrinkt.
Wie leben die
Elfen?
Der Überlieferung
nach leben sie in großen Gruppen zusammen. Manchmal unter einem König oder
einer Königin, manchmal aber auch ohne ein Oberhaupt. In Irland und England
haben Elfen eine Königin, in Wales und in Schweden werden sie von einem König
regiert, in Schottland hingegen gibt es gar keine Führung. Am
kompliziertesten ist das System in Island: Dort lebt der Elfenkönig in
Norwegen und die Elfen werden von einem Stadthalter geleitet, der alle zwei
Jahre zum König reist, um ihm zu berichten.
 |
Die Elfen feiern
zwei Feste – das eine, wenn die Sonne am Höchsten steht (Mittsommer), das
andere, wenn sie am Tiefsten ist. An Weihnachten veranstalten die Elfen um
Mitternacht einen grausigen Umzug. Die Sagen berichten, dass sie grün
angezogen sind und auf ihren Pferden und unter furchterregendem Geschrei
durch die Wälder und Wiesen reiten. Auch berichteten die Menschen, dass man
den Klang ihrer Hörner meilenweit hören konnte. Dieser Zug wird das „wütende
Heer“ genannt.
Für den Menschen
ist es nicht nur gefährlich, diesen Zug zu sehen, ihm zu folgen kann tödlich
sein. In der Nacht tanzen
die Elfen - bis zum Morgengrauen. Dies sieht man in Schottland, Skandinavien
und auch in Norddeutschland durch kleine, feine Elfenkreise, die morgens im
Gras zu sehen sind. Auf der Insel Mann konnte man der Überlieferung nach
diese kleinen feinen Fußspuren ab und zu auch im Schnee erkennen. |
Bei den Festen der
Elfen darf die Musik nicht fehlen. So pfeift auch zum Beispiel der Cluricaun
bei der Arbeit. In Norwegen machen die Elfen durch eine traurige Musik auf
sich aufmerksam, die auch Huldre slaat genannt wird. In Irland und
Schottland ist die Musik der Elfen jede Nacht aus den großen Hügeln zu hören.
Auf der dänischen Insel Seeland (die größte Ostseeinsel) und auch in Südschweden
sollen die Elfen ein Stück spielen, zu dem jeder, der es hört – selbst
leblose Dinge – tanzen muss.
Charakter der
Elfen
Der Charakter der
Elfen ist unterschiedlich: Manchmal zeigen sie sich hilfsbereit und gut,
dann wiederum boshaft und wollen den Menschen schaden. Von der Beschreibung
der Überlieferungen her sind die Elfen mit Vorsicht zu genießen, da der
Mensch bei ihnen niemals sicher sein kann, wie er dran ist.
Sie ärgern und
verspotten den Menschen gerne – damit wollen sie ihm aber keinen Schaden
zufügen. So nehmen die Elfen in Norwegen den Menschen ihr Werkzeug weg und
bringen es unter lautem Gelächter wieder. Der Zwergenkönig Laurin, dessen
Reich südlich von Bozen ist, überrascht die Menschen, die ihm in den Berg
folgen, mit plötzlicher Dunkelheit.
Besonders gerne
werfen die Elfen mit kleinen Steinchen nach den Menschen.
Obwohl die Elfen
die Menschen gerne necken, vertragen sie es nicht, wenn sie selbst das Ziel
von Streichen sind oder ausgelacht werden.
Wenn die Elfen sich
einmal zu den Menschen hingezogen fühlen, sind sie diesen auch treu. Sie
fordern aber vom Menschen die selbe Treue und werden böse, wenn er dieses
Wort nicht hält. Wenn sie bei einer Familie leben, sind sie dieser treu
ergeben.
Die größte Treue
erweist jedoch die irische Banshee einer Familie. Sie verkündet den
nahenden Tod eines Familienmitgliedes durch lautes Klagen. Die Banshee wird
als Frau mit langen, weißen Haaren beschrieben. Sie erscheint in der Nähe
des Hauses oder am Fenster vor dem Zimmer in dem der Kranke liegt, schlägt
die Hände zusammen und weint. Sie trägt einen weiten Mantel und der Kopf
soll von einem Schleier bedeckt sein.
Angeblich soll die
Stimme der Banshee jeden, der sie hört, sofort töten können. Sie wird
jedoch auch als tröstend beschrieben.
Aus Tirol und
Niedersachsen gibt es die Sage von der weißen Frau, die der Banshee ähnlich
sehen soll. In Schottland gibt es die bean-nighe. Diese Dame klagt nicht am
Fenster des sterbenden Menschen, wäscht dafür am Fluss die Totenhemden.
Laut der Überlieferung besitzt sie nur ein Nasenloch und hervorstehende Zähne.
Zwerge und Elfen stehlen auch gerne Dinge von den Menschen, besonders Lebensmittel. Sagen erzählen zum Beispiel von einem dänischen Trold, der Bier stehlen wollte. Als er dabei überrascht wurde, ist er geflohen und hat seinen Kupferkessel stehen gelassen. Auch der Däumling, der eigentlich ein kleiner Elf ist, stiehlt gerne. So stiehlt er dem Oger, einem menschenfressenden Wesen, die Siebenmeilenstiefel.
Elfen
und ihr Zauber
Allgemein können
sich Elfen sich unsichtbar machen. So besitzt der Elberich eine Nebelkappe,
mit der er sich unsichtbar machen kann. Elfen sind auch unheimlich schnell.
Sie können weit springen und Raum und Zeit überwinden. So heißt es vom
Cluricaun, dass er durch alle Schlüssellöcher gehen kann. Eine andere Sage
erzählt, dass eine irische Elfenkönigin von einem Berg zum anderen
innerhalb von drei Stunden springen kann. Elfen besitzen jedoch nicht nur übernatürliche
Kenntnisse, sondern teilen diese auch den Menschen mit.
|
Sie können auch
die Zukunft vorhersagen. So warnen sie den Menschen vor einem bevorstehenden
Unglück. Eine Sage erzählt darüber, dass die Bergmännchen dreimal an die
Wände des Stollens geklopft haben, um den Bergleuten den nahenden Tod zu
verkünden. Darüber hinaus
sind Elfen in der Lage, jede Gestalt anzunehmen. Oft sind sie so groß wie
die Menschen. Sie sind vom Aussehen her wunderschön und locken damit die
Menschen. Die Elfen besitzen
viele Künste. Laut der Edda haben sie mehr Kunstfertigkeiten als die Götter
selbst. Sie machen beispielsweise Odin sein zweischneidiges Schwert „Gugner“.
Der Sage nach kommt auch der Schmied Wieland aus dem Gedicht des deutschen
Übersetzers Karl Joseph Simrock (geb. 28. August 1802 in Bonn, gest. 18.
Juli 1876 in Bonn) zu den Zwergen in die Lehre. |
 |
Der Cluricaun
versteht sich auf die Anfertigung von Schuhen. Auch die Wichtelmänner in
deutschen Märchen beherrschen diese Arbeit: Sie machen das, was ein
Schuster untertags zugeschneidert hat, in der Nacht fertig.
Kleidung der
Elfen
Die Kleidung ist
bei den nordischen und den serbischen Elfen sowie auch bei den Vilen
(slawische, weibliche Wind- und Totengeister) weiß. Bei den Zwergen ist sie
meistens grün oder moosfarben. Von den dänischen Färöer-Inseln und auch
von Dänemark erzählen die Überlieferungen von einer grauen, manchmal auch
grünen Kleidung. Elfen, die wiederum mit den Menschen in Kontakt stehen,
haben bunte oder rote Rücke.
Wichtig bei der
Bekleidung ist die Kappe oder Mütze. So sollen die norwegischen Elfen, die
sonst ganz nackt sind, einen Hut auf dem Kopf tragen. Irische Elfen tragen
die Blüten des Fingerhuts auf dem Kopf oder haben weiße, breite Hüte, die
wie die Hüte von Pilzen aussehen. In Preußen haben sie spitze,
aufgekrempelte Hüte. Die dänischen Hausgeister wechseln die Hüte: Im
Sommer sind sie rund, ansonsten spitz. Auch in deutschen Sagen besitzen die
Elfen Hüte. So kann zum Beispiel Siegfried in der Nibelungensage sein Reich
durch eine Tarnkappe bekommen. Auch erzählen die deutschen Sagen von
unsichtbaren Zwergen, die die Menschen so lange mit Ruten schlagen, bis
diese ihnen die Tarnkappe oder den Hut vom Kopf schlagen konnten.
Der Hut hat eine
wichtige Funktion, weil sich die Zwerge damit vor den Menschen verbergen können.
Nahrung
der Elfen
Elfen ernähren
sich allgemein von flüssiger, zarter Nahrung. Erst dann, wenn sie mit den
Menschen in Verbindung stehen, wollen sie andere Nahrung. So ernähren sich
irische Elfen von Tautropfen und süßer Milch. Davon, dass die Elfen eine
Schale Milch erhalten, erzählen deutsche und walisische Sagen. Elfen mögen
aber auch kleine Brotbröckchen, Käse oder Weißbrot. In Preußen bekamen
sie Bier und Brot.
Die
Stimme und Sprache der Elfen
Laut der
Edda haben die Elfen eine eigene Sprache, die sich von denen der Götter,
Menschen und Riesen unterscheidet. Elfen sprechen leise, es ist mehr ein
Wispern wie die Luft. Aus Irland hingegen gibt es eine Sage, die von einem hässlichen,
alten Elfen berichtete, dessen Stimme beim Reden schnarrt. Ein Wechselbalg
spricht nicht, er schreit und heult und seine Stimme ist mit der eines alten
Mannes vergleichbar. Auch Waldgeister schreien. Und die serbischen Vilen
sollen eine Stimme besitzen, die mit der eines Spechts vergleichbar ist.
Der
Glaube an Elfen
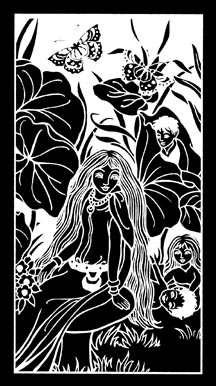 |
Der Glaube
an die Elfen ist uralt. So schrieb zum Beispiel schon Cassanius, ein
Geistlicher, der im 5. Jahrhundert in Marseille in Frankreich lebte, von den
Elfen. Er beschreibt die, die von den Menschen Waldgeister genannt werden.
Sie spielen und ärgern die Menschen. Und Cassanius kennt auch schon den
Alb, der den Menschen die Luft abdrückt. Verschiedene Schriften aus dem 10.
bis 12. Jahrhundert erwähnen auch die Hauswichtel, die die Menschen mit
kleinen Pfeilen und Kinderspielsachen ärgern. Der im 12. Jahrhundert lebende Rahewin war Schreiber und Notar des Bischofs Otto von Freising. Er schreibt, dass als die Kirche von Freising abbrannte, davor tagelang das Klopfen von Kobolden zu vernehmen war. |
Die
Elfen und der Teufel
Mit der
Christianisierung wurde der Glaube an Elfen und Zwerge ad Absurdum geführt.
Die Geistlichen setzten den Glauben an die Naturgeister mit dem Teufel
gleich. Durch dieses Verdammen der kleinen Wesen hatte sich auch schließlich
in der Bevölkerung an sich etwas geändert: Die Menschen mieden fortan die
Elfen, weil es ihrer Ansicht nach eine Sünde war.
Die Kirche
setzte die Elfen auch mit den Hexen in Verbindung: Und plötzlich deuteten
die Spuren im Gras, wo man früher noch an Tänze von Elfen glaubte, auf
hexisches Treiben hin. So tanzten plötzlich die Hexen in der Nacht auf
Kreuzwegen, auf Wiesen oder im Wald. Der Elfenpfeil wurde zum Drudenschuss
erklärt.
Und so wie
der irische Cluricaun auf Binsen reiten konnte, so ritten die Hexen auf Stöcken
oder auf Tieren durch die Lüfte. Wer von ihnen mitgenommen wurde oder
unbemerkt mitritt, der fand tage- oder wochenlang nicht mehr nach Hause. Und
natürlich wurde auch durch die Hexenprozesse ein unglaublicher Schaden für
den alten Volksglauben angerichtet.
Die Elfen in den Fantasy-Romanen
„Herr der Ringe“ und „Harry
Potter“ sind nur einige der Romane, in denen die Feen vorkommen. John
Ronald Reuel Tolkien (geb. 3. Januar 1983 in Bloemfontstein, Südafrika,
gest. 2. September 1973 in Bournemouth, England) veröffentlichte in den
60er Jahren den “Herr der Ringe”, sein Sohn Christopher bearbeitete nach
dem Tod seines Vaters dessen angefangene Skripten und veröffentlichte ab
1977 das Werk „Silmarillion“ und von 1983 bis 1996 die „History of the
Middle Earth“.
In letzterem Werk treten die
Elben als menschenähnliche Wesen auf, die in der Welt „Mittelerde“
leben. Sie sind auch nicht unsterblich, zeichnen sich jedoch durch Weisheit
und Schönheit aus. Sind die Elben erst einmal erwachsen, werden sie nicht
älter. Erkrankungen sind in der Elfenwelt unbekannt. Elben können jedoch
ermordet werden – ihre Seele bleibt dann immer mit der Mittelerde
verhaftet. Ihre Kultur haben die Menschen von diesem Völkchen, das schon
lange vor den Menschen in Mittelerde lebte. Besonderen Wert legte der Autor
dabei auf die Sprache seiner Elben, die er detailliert ausarbeitete.
Tolkien nennt zwei Gruppen von
Elben: Einerseits die Eldar, die vor Jahrhunderten in den Westen zogen und
die Avari, die bei den Menschen blieben. Bei den Eldar existieren drei Stämme
– die Yanyar, die Noldor und die Teleri. Auch die Teleri sind wiederum in
einige Gruppen unterteilt, wobei die Nandor und die Sindar sich dem Rest
ihres Volkes nicht anschlossen und in Mittelerde blieben. Auch die Noldor
kehrten nach Mittelerde zurück. Hier fügt Tolkien zu den Licht- und den
Dunkelelben noch eine dritte Gruppe, jene der Grauelben hinzu. Das sind die
Elben, die die Wanderung in den Westen zwar begonnen, aber nicht beendet
haben.
Tolkien hatte eine Abneigung
gegen das Wort „Elfen“, weil er die Vorstellung als kleine Wesen, die
auf den Blumen sitzen, die in der Neuzeit aufkam, nicht mochte. Daher bat er
die Übersetzerin im Deutschen statt dessen die Wörter „Elben“,
„Alben“ oder „Alpe“ zu verwenden. Seine Geschichten sind an Elemente
aus verschiedenen Mythologien geknüpft – beispielsweise an die nordische
– lehnen sich aber auch an christliche und philosophische Vorstellungen
an.
Elfen in der moderneren Literatur
Die Elfen, die in der moderneren
Literatur auftauchen, sind gute, friedliche Wesen nach dem Stoff Tolkiens.
Andererseits gibt es auch die Dunkelelfen oder Alben, die das Gegenteil
darstellen. Diese Elfen sind entweder böse geboren oder sind vom „guten
Weg“ abgewichen. Als dritte Gruppe gibt es auch noch die neutralen
Nachtelfen.
Bösartige Elfen finden sich zum
Beispiel in Terry Pratchetts „Lords and Ladies“. Diese
Sorte Elfen, die Pratchett beschreibt, sind ekelhaft und grausam.
In den meisten Fantasy-Erzählungen
haben die Elfen spitze Ohren, sind von der Statur her zierlich und
musizieren gerne. Der aus einer Beziehung zwischen Elfen und Menschen
entstammende Nachwuchs wird als Halbelf bezeichnet. Ab und zu ziehen die
Elfen auch mit anderen Völkern in den Krieg – beispielsweise mit den
Zwergen oder Gnomen.
In J.K. Rowlings
„Harry Potter“ kommt der Hauself vor, den sie als Abwandlung eines
englischen Brownies beschreibt. Anders als diese Wichtel oder Gnome sind
Hauselfen jedoch an den Willen ihrer Besitzer gebunden.
Die Elfenbeauftragte von Reykjavik
Sie heißt Erla Stefánsdóttir
und ist heute 71 oder 72 Jahre alt. In Deutschland wurde sie durch einen
Artikel der Frankfurter Rundschau im Jahr 1995. Erla Stefánsdóttir hat für
die Tourismusabteilung der Stadt Reykjavik drei Elfenkarten gezeichnet.
Hauptberuflich ist sie Klavierlehrerin, übt also kein offizielles Amt aus.
Nach eigenen Angaben besitzt sie
seit ihrer Kindheit die Gabe, Elfen sehen zu können. Es gibt auf Island
ungefähr 60 verschiedene Arten von Elfen, sagt die Frau, die von sich
behauptet, ein Medium zu sein. Von der Größe her sind Elfen zwischen ein
paar Millimetern und mehreren hundert Metern groß.
In Island gehören Steine oder
Felsen, die von der Bevölkerung als „von Elfen bewohnt“ bezeichnet
werden, zu den Kulturgütern. Der Glaube daran, dass in Hügeln oder Steinen
die Elfen daheim sind, kommt aus Märchen. Wenn in der Nähe eines solchen
Kulturgutes ein Bauvorhaben geplant ist, werden Erla Stefánsdóttir oder
auch andere elfenkundige Menschen geholt, die dann ein Gutachten erstellen.
|
Álfastein
(Elfenhügel) in Kópavogur bei Álfholsvegur 125. |
Darüber hinaus katalogisiert sie
auch die Plätze der Gnomen, Trolle oder Lichtfeen. Daraus hat sie drei
Elfenkarten gemacht. 2004 ist ein Buch über ihre Kenntnisse in isländischer
Sprache erschienen, seit 2007 gibt es dieses Buch unter dem Titel „Lífssýn
mín – Lebenseinsichten der isländischen Elfenbeauftragten“ auch in
deutscher Sprache. Das bekannteste Beispiel, das auf
eine Elfenwohnstätte hinweist, ist eine Straßenverengung zwischen Reykjavík
und Kópavogur. Diese Straßenverengung wurde vor dem Haus 125 gebaut. Dort
identifizierte Erla Stefánsdóttir einen Hügel als Behausung der Elfen.
Einen anderen Fall gibt es in der Stadt Grundarfjörður: Dort gibt es das
Haus Nummer 82 und das Haus Nummer 86 – auf Nummer 84 leben die Elfen.
|
Die Feen
Der
Name der Feen stammt von den römischen Schicksalsgöttinnen, den Fata oder
Parzen[2],
ab. Die Fata heißen lateinisch Fatua, italienisch Fata, auf Spanisch Hada
und auf Französisch schließlich Fée. Die enge Verbindung der Feen mit dem
Schicksal kommt daher, dass das lateinische Wort „fatua“, was
Wahrsagerin bedeutet, von „fatum“ (Schicksal) abstammt. Doch es gibt
noch ein anderes, aus dem Romanischen stammendes Wort, das sich auf die Feen
zurückführen lässt: Fei, von dem sich Merfei oder Waldfei ableiten lässt.
Auch „gefeit“ stammt von „fei“ ab, was sich wiederum auf die
Unverwundbarkeit gegen den Zauber der Feen bezieht.
In
der deutschen Poesie des Mittelalters tauchen die so genannten Feien oder
Feinen auf, die wiederum mit den weißen Frauen und den Nornen
verwandt sind. Im slawischen Raum heißen die Feen Vila, im keltischen sind
es die Sidhe, die als Nachkommen der Tuatha de Danaan, der irischen Urbevölkerung,
bezeichnet werden.
Eigenschaften
der Feen
 |
Zahlreiche
Sagen, Legenden und Mythen, die es über die Feen gibt, erzählen darüber,
dass die Feen meistens in Gruppen auftreten. Oft sind sie zu dritt, weniger
oft zu siebent oder zu zwölft. Sie bestimmen das Schicksal der Neugeborenen
(siehe Dornröschen), leben in den Schluchten von Felsen und können sich
unsichtbar machen. Vom
Aussehen her sollen sie unglaublich schön und ewig jung sein. Sie haben
immer gute Laune und sollen Glücksbringer sein. Sie tanzen sehr gerne, mit
Vorliebe in Wäldern, an Quellen und in den Grotten der Felsen. Das haben
die Feen im Übrigen auch mit den Nixen gemein. Der Mensch kann an den so
genannten Feenringen (cercles des flées) erkennen, dass die Feen da waren.
Darüber hinaus werden sie aber von den Menschen auch des öfteren entdeckt,
wenn sie ihre Wäsche waschen. Die verschiedenen Bezeichnungen der Schriftsteller für die Feen, wie etwa felices dominae, bonae mulieres oder dominae nocturnae, wurden später auch für andere Wesenheiten verschiedener Überlieferungen, beispielsweise auf jene der Wilden Frauen, angewandt. |
Die Feen in der Literatur
|
Die Geschichten über die Feen
sollen sich durch die Kreuzzüge zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert
entwickelt haben, als durch die Kultur der Perser und Araber mit den
Gestalten von Peris (Elfen in der persischen Mythologie) und Dschinnen ins
Abendland Einzug hielten. Einer der Vorläufer dieser Geschichten aus der
Feenwelt war die Sage „Lancelot vom See“ aus dem 14. Jahrhundert, die
von verschiedenen Autoren aufgegriffen und je nach Autor unterschiedlich erzählt
wurde. Der Inhalt erzählt – mit einigen Veränderungen je nach
Schriftsteller - von Lancelot, der als Kind von der Fee Vivianne geraubt und
groß gezogen wird. Später wird er einer der Ritter der Tafelrunde von König
Artus, verliebt sich jedoch in dessen Frau Gwenhwyfer und ist durch diese
Liebe unwürdig, nach dem Heiligen Gral zu suchen. Der Feenglaube wurden später im
Roman „Huon de Bordeaux“ weiter ausgebaut. Dessen Vorlage verwendete
wiederum Christoph Martin Wieland für seinen „Oberon“. Sogar ins
christliche Rittertum hielten die Feen Einzug.
|
Die Elfenkönigin Titania von Johann Heinrich Füssli, einem Schweizer Maler und Publizist (geb. 7. Februar 1741 in Zürich, gest. 16. April 1825 in Putney bei London). In England wurde er unter dem Namen Johann Fuseli bekannt. |
Der englische Dichter Edmund
Spenser (1552 bis 1599 in London) läutete mit seinem Gedicht „The Faerie
Queene“ eine Epoche der angelsächsischen Literatur, nämlich die
englische Renaissance, ein. Er verwendete absichtlich eine altertümliche
Sprache aus der er eine Dichtung machte, die eigentlich für die Königin
Elisabeth I. gedacht war. In „The Faerie Queen“ wird der christliche
Glaube mit der Artus-Sage verbunden. 1590 veröffentlichte er die ersten
drei Bände, die anderen drei Bände folgten 1596.
Während die Feen, wie sie Spenser beschreibt, anfangs noch ganz die guten, wohlwollenden Feen sind, spaltet sich im Verlauf des Werks ihr Charakter. So sind die jungen Feen, die er Esterelle, Maliure und Melusine nennt, ewig schön, jung und gut. Dann tauchen aber auch noch andere Feen auf, unter anderem Karabossa und Fanferlüsch. Diese Feen waren böse und besaßen auch größere Macht. Auch das Schicksal der Feen, das keine Fee einen Zauber, den eine gewirkt hat, aufheben kann, findet sich hier zum ersten Mal. Später wird das in mehreren Sagen und Märchen fortgesetzt – zum Beispiel beim „Dornröschen“ der Gebrüder Grimm.
Der Stoff, aus dem die Feenmärchen sind
Besonders im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts entstanden in Europa verschiedene Feenmärchen, die vor allem in Frankreich sehr beliebt waren. Ihr Ursprung lag in den orientalischen Ländern. Und so waren sie auch vom Inhalt her eine Verbindung dieser orientalischen Sagen und realen Erlebnissen. Vor allem beim Adel Frankreichs fanden diese Feenmärchen sehr viel Anklang. Ein Beispiel ist „Die Schöne und das Biest“, das noch heute ein beliebtes Musical ist. Auch in die Alt-Wiener Volkskomödie hielten die Feenmärchen Einzug. Ferdinand Raimund (1. Juni 1790 in Wien, gest. 5. September 1836 in Pottenstein, Niederösterreich) verarbeitete diesen Stoff zu seinen bekannten Zauberpossen. Bekannte Werke sind „Der Diamant des Geisterkönigs“ (1824), „Das Märchen aus der Feenwelt oder der Bauer als Millionär“ (1826), „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ (1828) sowie „Der Verschwender“ (1834). Johann Nestroy (7. Dezember 1801 in Wien, gest. 25. Mai 1862 in Graz) führte das Erbe Raimunds fort und machte aus den Feenmärchen realistisch-satirisches Volkstheater oder Phantasiekomödien. Auch Johann Strauß Sohn (geb. 25. Oktober 1825 in Wien, gest. 3. Juni 1899 in Wien) komponierte 1866 ein „Feenmärchen“.
|
In Frankreich waren es vor allem
der französische Schriftsteller Charles Perrault (12. Januar 1628 in Paris,
gest. 16. Mai 1703 in Paris), der mit seinem Märchen „Contes da la mère
l’Oye“ (1697), die „Contes de fèes“ (1698) und die französische
Schrifstellerin Marie-Catherine d’Aulnoy (1650 in Barneville-la-Bertran,
gest. 1705 in Paris), die beim Publikum sehr beliebt waren. Dadurch kam
Antoine Galland (4. April 1646 in Rollot, Picardie, gest. 19. Februar 1715
in Paris) auf die Idee, die orientalische Märchensammlung „Tausendundeine
Nacht“ ins Französische zu übersetzen. Die Dichtungsgattung selbst fand
in der Regel jede Menge Nachahmer, wobei die besten Feenmärchen in 41 Bänden
im „Cabinet des fées“ (1785 bis 1789) gesammelt sind. Natürlich gab es
auch Gegner dieser Dichtungsgattung – der bekannteste Opportunist war
Nicolas Boileau (1. November 1636 in Paris, gest. 13. März 1711 in Paris)
mit seinen Schülern. In Deutschland verfasste
Christoph Martin Wieland die Sammlung „Dschinnistan“ (1786 bis 1789).
Sie enthält 19 Märchen, von denen zwölf von Wieland selbst geschrieben
wurden, vier weitere stammen von seinen Freunden. Schließlich war die Gesellschaft
jedoch von dieser Erzählgattung übersättigt und die Feen wurden in die
Kinderbücher verbannt. |
 |
Während sie in den Märchen der
Gebrüder Grimm nun ab und zu auftauchen, spielen sie zum Beispiel bei
Charles Perraults „Cinderella“ , in E.T.A. Hoffmanns „Klein Zaches,
genannt Zinnober“ (24. Januar 1776 in Königsberg, gest. 25.
Juni 1822 in Berlin) oder bei Carlo Collodi „Pinocchio“ (24. November
1826 in Florenz, gest. 26. Oktober 1890 in Florenz) vor. Während die Feen
bei Hoffmann vom Landesherrn ins Nonnenkloster geschickt werden, spielen sie
wiederum bei Pinocchio eine entscheidende Rolle, hängt doch das Glück des
kleinen Holzmannes entscheidend von der Fee ab. Auch dem Kasperl von Otfried
Preußler (20. Oktober 1923 in Reichenberg, Böhmen) glückt die Erlösung
einer verzauberten Fee.
Die Wilden Weiber
Das ist eine eigene Kategorie
von Wesenheiten, die vor allem die Gebirge der Schweiz bis Kärnten
bewohnen. Laut den Gebrüder Grimm sollen sie am ehesten den Elben, Wichteln
und Zwergen ähneln. Es sind niedere Geschöpfe, die in verwandtschaftlichen
Beziehungen leben – also als Mann, Frau und Kind. Kommen sie einzeln vor,
ähneln die Männer Riesen, die Frauen gleichen jedoch Göttinnen. Je nach
Ort haben sie auch verschiedene Namen: So kommen sie im deutschen
Volksglauben im Mittelgebirge nach den Rüttel- oder Rittelweibern, in
Mitteldeutschland, Franken und Bayern sind die als Holz- oder Moosleute
bekannt, im Böhmerwald und der Oberpfalz als Holz- oder Moosfräulein, im
Harz den Moos oder- Holzweiblein, um Halle herum heißen sie Lohjungfern und
in Westfalen Buschweiblein. In den Alpen nennt man sie Norglein, Nörglein, Nörkel oder Örggeler.
Vom
Wesen her sind die Wilden Weiber unberechenbar. In einigen Sagen werden sie
als gutmütig beschrieben, dann aber wieder als böse. Darin tritt auch die
Angst zutage, die die Menschen früher vor dem Wald hatten. So rächen sich
die Wilden Weiber an denjenigen, die sie verspotten oder fürchten.[3]
Die kleinen Wilden Weiber kann man schnell versöhnen, die großen jedoch
sind unberechenbar und können den Menschen aus lauter Wut sogar zerreißen.
Die riesigen Wilden Weiber leben überwiegend in Tirol. Sie sind hässlich,
stark, haben Stoßzähne wie ein Tier, schwarze, rußige Haare, sind am
ganzen Körper behaart, haben lange Nägel und eine kräftige, raue Stimme.
Sie haben auch eigene Tiere, wie zum Beispiel einen schwarzen Stier. Und sie
tragen einen eigenen Stock, beispielweise eine ausgerissene Tanne mit
Wurzeln, eine Eisenstange oder eine Keule.
Die Wildfrau unterscheidet sich
vom Wilden Mann nur wenig – eines ihrer Kennzeichen sind jedoch die Hängebrüste.
Die Wilden Weiber können aber auch wunderschön sein, mit dichten, hellen
Haaren und einer angenehmen Stimme. Sie sind nackt, reiben gegen die Kälte
mit Fett (Hexenschmalz) ein oder tragen Fuchsfälle.
[1]
W. Grant Stewart “The popular superstitions and festive amusements of
the Highlanders of Scotland”, Edinburgh“ 1823
[2]
Parzen,
lateinisch auch Parcae genannt, spinnen das Schicksal der Menschen. Eine
Göttin spinnt den Faden, die zweite trennt ihn auf und die dritte
schneidet ihn ab. Die Namen der Parzen sind Nona, Decima oder Decuma und
Morta. In der germanischen Mythologie heißen sie Nornen, in der
griechischen Moiren und in der slawischen Mythologie Zorya.
[3]
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, S. 28931, (vgl. HWA Bd. 9N,
S. 970)


